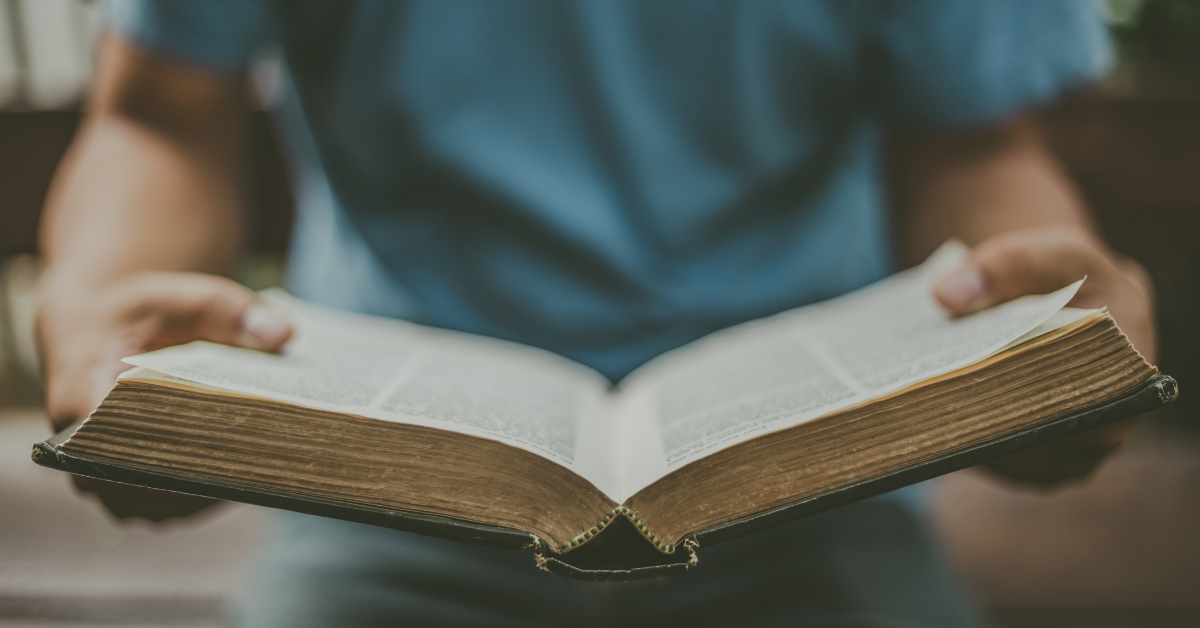1.Johannes 1,3: “…was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt; und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus.”
Das Zeugnis, das Johannes in 1. Johannes 1,3 weiterführt, ist von zentraler Bedeutung für das Verständnis des christlichen Glaubens. Mit der dreifachen Bekräftigung „was wir gesehen und gehört haben“ geht es nicht um bloße Ideen oder spirituelle Visionen – es geht um konkrete, erfahrbare Realität. Johannes bezeugt nicht Mythen oder Fabeln, sondern die physische Gegenwart Jesu Christi in Raum und Zeit. In einer Welt, die von Sünde und Entfremdung geprägt ist, tritt Gott selbst in die Geschichte ein. Die Offenbarung des Lebens in Christus ist kein philosophisches Konzept, sondern ein greifbares Ereignis.
Die Weitergabe dieser Erfahrung hat einen zutiefst gemeinschaftlichen Charakter. Es ist nicht nur ein historischer Bericht, sondern eine Einladung zur Teilhabe am göttlichen Leben. Die Gemeinschaft mit den Aposteln ist nicht rein menschlich, sondern gründet sich auf die gemeinsame Beziehung zu Gott, dem Vater, und zu Jesus Christus, dem Sohn. Hier wird die Gemeinschaft durch Teilhabe greifbar – eine geistliche Verbundenheit, die aus dem Erleben und Erkennen Gottes entspringt. Der Glaube ist also nicht individualistisch, sondern wird in der Gemeinschaft gelebt und gestärkt.
Gerade in unserer Zeit, wo Glaube oft wie Nebel behandelt wird – etwas Diffuses, das man nicht greifen kann – ist es umso wichtiger, sich an die feste Gestalt des historischen Wirkens Gottes zu erinnern. Das heißt: Angesichts moderner Tendenzen, das Christentum in symbolische Deutungsmuster zu überführen, wird die geschichtliche Realität von Christi Leben, Tod und Auferstehung zu einem unverzichtbaren Ankerpunkt der bibeltreuen Theologie. Die Bibel besteht nicht aus eine Sammlung symbolischer Gleichnisse – sie bezeugt Gottes konkretes Handeln in der Geschichte. Das Leben Jesu von Nazareth, sein Wirken, sein Leiden, Sterben und Auferstehen, ist der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Dieses Geschehen ist mit menschlichen Sinnen erfassbar, von Zeugen belegt und in Schriften überliefert, sodass es auch für uns heute relevant und zugänglich ist.
Das apostolische Augenzeugentum bezeugt die unmittelbare Erfahrung und Wahrnehmung der Jünger, die Jesus Christus gesehen, gehört und berührt haben – und somit den Glauben auf ein real erlebtes Fundament stellen. Petrus bekräftigt dies mit Nachdruck: Sie folgten keinen Fabeln oder erfundenen Geschichten, sondern waren Augenzeugen der Herrlichkeit Christi: “Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus; sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen” (2.Petrus 1,16). Die Erfahrung, mit eigenen Augen gesehen zu haben, gibt dem apostolischen Zeugnis eine einzigartige Autorität. Es geht nicht um Hörensagen, sondern um unmittelbare Begegnung mit dem lebendigen Gott. Diese Augenzeugenschaft ist das Fundament, auf dem das Vertrauen der Gemeinde auf Gottes Eingreifen ruht.
Gott hat in Jesus Christus in die Geschichte eingegriffen – real, sichtbar, erfahrbar. Dieses Handeln ist das Herzstück des christlichen Glaubens und bildet die Brücke zwischen göttlicher Realität und menschlicher Erfahrung. Indem wir dieses Zeugnis weitergeben und in der Gemeinschaft leben, treten wir ein in eine lebendige Verbindung mit Gott, die über alle Zeit hinaus Bestand hat.
Der Apostel Johannes stellt in 1. Johannes 4,2 eine bemerkenswerte Verbindung her zwischen der historischen Realität Jesu Christi und dem Erkennen des wahren Geistes: „Daran erkennt ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott.“ Dieses Bekenntnis zur Fleischwerdung – zur Inkarnation – ist nicht bloß ein theologischer Lehrsatz, sondern das zentrale Kriterium für echtes Christsein. Johannes betont damit: Wer das Kommen Jesu im Fleisch leugnet, also die geschichtliche Realität seiner Menschwerdung, entzieht dem Evangelium seine Grundlage. Die Wahrhaftigkeit der christlichen Botschaft steht und fällt mit der Anerkennung, dass Gott in Raum und Zeit handelt – dass das Ewige ins Zeitliche eingedrungen ist, konkret und erfahrbar.
Nimmt man dieser Wahrheit ihre historische Dimension, verliert der Glaube seine Erdung und seine Grundlage. Ein Jesus, der nicht wirklich geboren wurde, nicht litt, starb und auferstand, wird zur Idee, zum Mythos, zu einem bloßen Symbol. Die Wirklichkeit Gottes entschwindet ins Abstrakte – zurück bleibt ein Gedankengebilde, ein philosophischer Begriff ohne Kraft und Bindung. Der Gott der Bibel aber ist kein Konzept, sondern eine lebendige Person, die in die Geschichte hineingesprochen und darin gehandelt hat. Die historische Wahrheit der Bibel ist daher weit mehr als ein theologisches Detail – sie ist das Fundament, auf dem die Glaubwürdigkeit und Verbindlichkeit des christlichen Glaubens ruht. Wer sie bestreitet, stellt letztlich auch die Existenz und das Wesen Gottes in Frage, wie ihn die Heilige Schrift offenbart. Denn der biblische Gott ist nicht nur der Schöpfer der Welt, sondern auch ihr Erlöser – ein Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist und der in der Geschichte sichtbar und erfahrbar wurde.
Johannes macht unmissverständlich klar: Die Geistunterscheidung im christlichen Glauben beginnt dort, wo das Bekenntnis zur fleischlichen Realität Christi steht. Die Geschichtlichkeit ist nicht der Randbereich des Glaubens, sondern sein innerstes Zentrum. Ein Gott, der nicht handelt, ist nicht der Gott der Bibel. Er bleibt ein Konzept – unverbindlich, ohne Anspruch, ohne Gegenwart. Doch der Gott, der sich in der Geschichte offenbart hat, ruft zur Entscheidung, zur Nachfolge, zur Gemeinschaft. Und genau darauf gründet sich die christliche Hoffnung.
Der göttliche Missionsauftrag
Das Evangelium von Jesus Christus ist keine Geheimlehre, kein verborgenes Wissen für eine exklusive Elite. Es ist die Botschaft Gottes an die Welt – offen, klar und zugänglich für jeden Menschen. Die Apostel bezeugen dies mit einer tiefen inneren Dringlichkeit. Ihre Worte in Apostelgeschichte 4,20 – „Wir können’s ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben“ – offenbaren eine überwältigende Erfahrung, die sie nicht für sich behalten konnten. Sie waren Zeugen von etwas so Gewaltigem, so Lebensveränderndem, dass Stille keine Option war. Die Verkündigung wurde zur inneren Notwendigkeit, zur Bewegung, die Herzen erreichen will.
Die Frohe Botschaft ist universal – sie überschreitet Grenzen von Kultur, Sprache und Herkunft. „Wir verkündigen euch“ – das „euch“ ist nicht exklusiv gemeint, sondern inklusiv: Es schließt jeden ein, der bereit ist zu hören. Das Evangelium ruft nicht zur Isolation, sondern zur Öffnung. Die Gemeinde Christi lebt vom Weitergeben, vom Teilen dessen, was gesehen und gehört wurde: die rettende Liebe Gottes, sichtbar in Christus. Dabei geschieht Evangelisation nicht abstrakt oder distanziert, sondern persönlich. Die Verkündigung erreicht den Einzelnen mitten in seiner Lebenswirklichkeit, durch das gesprochene Wort, durch gelebtes Zeugnis und durch geisterfüllte Präsenz. In dieser Begegnung mit der Wahrheit des Evangeliums wird der Mensch innerlich angerührt – das Herz wird geöffnet, der Geist erwacht, und der Glaube wird geboren.
Die Apostel wurden durch äußere Mächte bedrängt und bedroht, doch die Kraft des Evangeliums war stärker als jede Angst. Sie konnten nicht schweigen, weil das, was sie erfahren hatten, das Fundament ihres Seins geworden war. Auch heute bleibt dieses Zeugnis lebendig – durch Predigt, durch Lieder, durch persönliche Geschichten und durch das Leben der Gläubigen. Die Gemeinde wird zum Sprachrohr Gottes in einer Welt, die nach Wahrheit und Hoffnung dürstet. Die Offenbarung Gottes in Christus ist kein exklusives Geheimnis, sondern eine öffentliche Einladung: „Kommt und seht!“ (Johannes 1,39). Die Verkündigung ruft zur Umkehr, zur Nachfolge, zur Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Wer hört und glaubt, wird hineingenommen in das neue Leben, das durch Christus möglich geworden ist. Deshalb ist Predigt nie bloße Rede – sie ist geistliche Bewegung, göttliche Initiative, menschliche Antwort.
Das Evangelium ist Licht, das nicht unter einen Scheffel gehört. Es muss leuchten, muss gehört, gesehen, geglaubt und gelebt werden. Die Kirche Jesu Christi ist nicht nur Bewahrerin des Evangeliums, sondern vor allem seine Botin. Die Worte der Apostel hallen bis heute durch die Jahrhunderte: Wir können und dürfen nicht schweigen. Und so ist jeder Gläubige berufen, diese Wahrheit weiterzutragen – nicht aus Zwang, sondern aus überwältigender Freude an der rettenden Wahrheit Gottes.
„Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern: Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ (Matthäus 28,19–20). Dieser Vers ist der zentrale Auftrag Jesu an seine Jünger nach seiner Auferstehung – ein Ruf zur weltweiten Verkündigung, zur Taufe und zur Lehre. Er bildet die Grundlage für christliche Mission und Evangelisation bis heute. Amen.