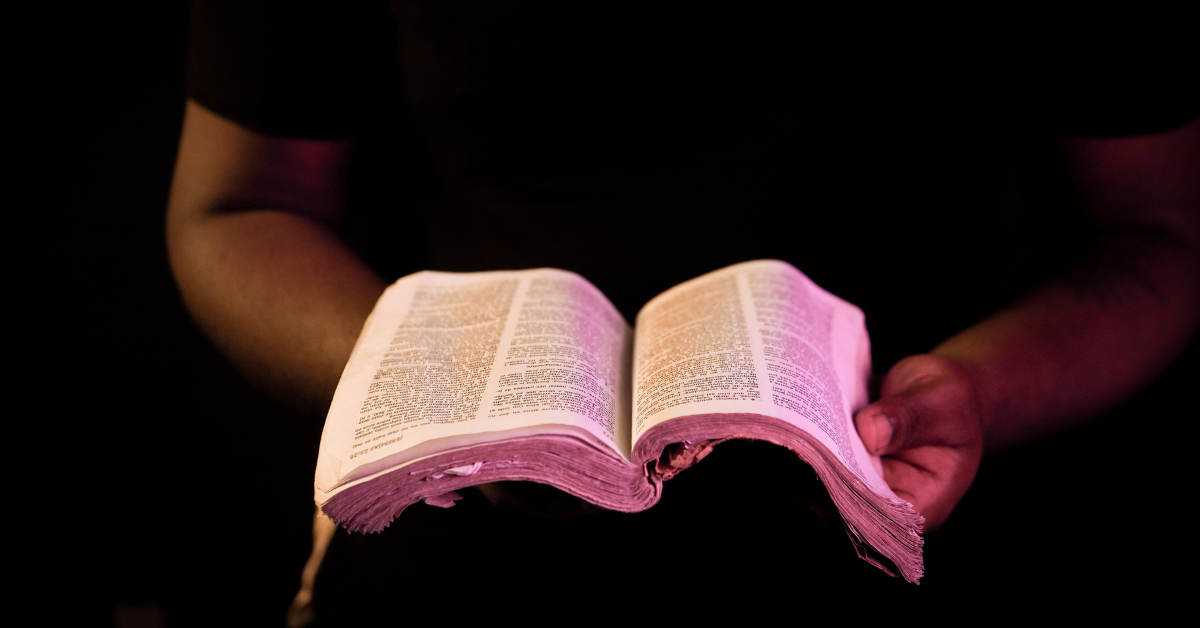Matthäus 5,43–44: “Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Du sollst deinen Nächsten lieben« und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel.”
In Matthäus 5,43 nimmt Jesus Bezug auf ein bekanntes alttestamentliches Prinzip und konfrontiert es mit einer revolutionären Botschaft: Die Liebe gilt nicht nur dem Nächsten, sondern auch dem Feind. Dieser Vers bildet die Einleitung zu einem radikalen Paradigmenwechsel in der Bergpredigt, in dem Jesus die ethischen Grenzen menschlicher Beziehungen verschiebt. Die Aufforderung, den Feind zu lieben, stellt gängige Vorstellungen von Gerechtigkeit und Vergeltung auf den Kopf und lädt dazu ein, göttliche Barmherzigkeit in zwischenmenschliche Konflikte zu tragen. Damit wird Liebe nicht nur zur moralischen Verpflichtung, sondern zum aktiven Ausdruck göttlicher Gegenwart im Alltag.
Die Frage „Wer ist mein Nächster?“ durchzieht die christliche Ethik wie ein roter Faden. Jesus selbst sprengt in seinen Worten und Taten die engen Grenzen familiärer und nachbarschaftlicher Bindung und fordert einen Perspektivwechsel, der unser Herz herausfordert: Nicht nur die, die uns nahestehen: Der Begriff „Nächster“ umfasst nicht nur Freunde, Familie oder den sympathischen Nachbarn. Die Liebe, von der Jesus spricht, ist nicht bequem oder selektiv, sondern mutig und unberechenbar in ihrer Weite. Auch jene, die wir nicht lieben können oder wollen: Genau hier wird die Botschaft radikal. Den Feind zu lieben ist keine Gefühlsduselei, sondern eine Entscheidung zur Versöhnung, zur inneren Freiheit. Es bedeutet nicht, Grenzüberschreitungen zu dulden, sondern sich dem Hass zu verweigern. Lieben als geistlicher Akt: Jesus lädt dazu ein, in jedem Menschen das göttliche Bild zu erkennen, selbst in denen, die uns verletzen oder fremd sind. Die entscheidende Frage lautet also nicht: Wer ist mein Nächster? Sondern: Wem bin ich bereit, zum Nächsten zu werden? Diese Haltung verändert nicht nur, wie wir die Welt sehen – sie verändert auch, wie wir darin handeln. Sie eröffnet Räume für Heilung, für Brücken statt Mauern.
Die Aufforderung Jesu, „Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen“ (Matthäus 5,44), ist eine der herausforderndsten Aussagen des Evangeliums. Sie steht quer zu jeder menschlichen Logik von Vergeltung und Abgrenzung. Während viele religiöse und gesellschaftliche Systeme über Jahrhunderte Feindbilder kultiviert haben – bis hin zu heiligem Hass – zeigt Jesus einen Weg, der aus diesem Kreislauf befreit.
Feindesliebe ist kein sentimentales Gefühl, sondern ein mutiger Akt geistlicher Reifung. Sie beginnt dort, wo wir uns weigern, den anderen auf seine Schuld zu reduzieren. Gerade in Momenten der Verfolgung – in der extremsten Zuspitzung von Feindschaft – fordert Jesus: „Betet für eure Verfolger.“ Dieses Gebet ist keine Flucht, sondern eine revolutionäre Geste der Liebe. Es entwaffnet nicht den Gegner, sondern den eigenen Hass. Wer für seine Verfolger betet, liebt auf göttliche Weise – bedingungslos, heilend, frei von Vergeltung. Die Fürbitte für Verfolger ist der vollendetste Ausdruck gelebter Liebe.
Das Kreuz ist dafür das stärkste Symbol: Jesus selbst bittet in seinen Todesqualen für die, die ihn kreuzigen und verspotten – „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“ (Lukas 23,34). Es ist die tiefste Form der Fürbitte. Und Stephanus, der erste christliche Märtyrer, übernimmt genau diesen Geist in seinem letzten Atemzug: “Er fiel auf die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an! Und als er das gesagt hatte, verschied er” (Apostelgeschichte 7,60). Die Urgemeinde lebte diese Haltung kompromisslos: Feindesliebe als gelebte Theologie.
Feindesliebe als gelebte Theologie – ein radikaler Anspruch, der uns oft überfordert und gleichzeitig herausfordert. Sie bedeutet mehr als bloße Toleranz oder moralische Größe. Sie ist ein Ausdruck jener göttlichen Perspektive, die Menschen nicht nach Leistung oder Loyalität bewertet, sondern nach ihrer Würde als Ebenbild Gottes. Doch in einer Welt, in der Polarisierung, Rachefantasien und schnelle Urteile den Ton angeben, scheint die Fähigkeit, den Feind zu lieben, fast abhanden gekommen. Wir reden von Versöhnung, aber leben häufig in Abgrenzung. Wir zitieren Christus, doch meiden den Kreuzweg der radikalen Vergebung. Gelebte Theologie beginnt dort, wo Worte zu Taten werden. Wenn wir Fürbitte halten für jene, die uns verletzen, dann treten wir in jene göttliche Dynamik ein, die Heil statt Vergeltung sucht. Es ist unbequem. Es tut weh. Und genau darin liegt ihre Kraft. Vielleicht braucht unsere Zeit nicht mehr Religion, sondern mutigere Nachfolge – die bereit ist, selbst in der Konfrontation das Gesicht Gottes zu erkennen und zu zeigen.
Denn Feindesliebe ist keine Option unter vielen – sie ist Kernbotschaft des Evangeliums. In einer Theologie, die sich ernsthaft an Christus orientiert, darf Feindesliebe nicht zur Randnotiz verkümmern. Sie ist Ausdruck jener radikalen Gnade, die selbst den Kreuzestod nicht scheute. Wenn Jesus am Kreuz für seine Peiniger betet („Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“), dann entlarvt er jede Form von religiöser Selbstgerechtigkeit und fordert eine Ethik des Übermaßes – eine Liebe jenseits des Machbaren.
Gesellschaftlich betrachtet befinden wir uns mitten in einer zunehmenden Verhärtung des Diskurses. Die Empathie, einst Grundpfeiler des menschlichen Miteinanders, weicht einem Klima der Polarisierung, in dem Abgrenzung und moralische Verurteilung gängige Praxis sind. Wer anders denkt oder fühlt, wird nicht selten auf seine vermeintliche Andersartigkeit reduziert – stigmatisiert statt verstanden, etikettiert statt eingebunden. Gerade hier entfaltet das christliche Prinzip der Feindesliebe seine sprengende Kraft: Es steht diametral zur Logik von Lagerdenken, Rechthaberei und identitärer Selbstvergewisserung. Es fordert nicht bloß Toleranz, sondern eine radikale Hinwendung zum Anderen – zur gemeinsamen Menschlichkeit, die auch da besteht, wo Verletzungen noch bluten. Theologisch gesehen ist Feindesliebe eine Nachahmung des göttlichen Herzens. Sie verkörpert die Überzeugung, dass Gnade nicht verdient, sondern geschenkt wird – und dass der Mensch nicht aus seiner Leistung heraus geliebt wird, sondern trotz seiner Brüche. In dieser Sichtweise wird jede Begegnung zur potenziellen heiligen Stätte, an der sich Versöhnung ereignen kann. Nicht als Harmonie-Illusion, sondern als gereifte Form der Verantwortung füreinander. In einer Gesellschaft, die Spaltung normalisiert, ist Feindesliebe kein Rückzug in Passivität, sondern ein aktiver Protest gegen das Prinzip der Vergeltung. Sie ist Widerstand gegen die Zersetzung des sozialen Gewebes, gegen den reflexhaften Ruf nach Strafe und Ausschluss. Sie verlangt ein ethisches Wagnis: die Zumutung, den Feind nicht als Bedrohung, sondern als Mit-Menschen zu begreifen. Und vielleicht beginnt echte Erneuerung nicht dort, wo die Systeme reformiert werden, sondern wo Menschen sich entscheiden, anders zu handeln – zu beten für die, die ihnen wehtun, und so jener Liebe Raum zu geben, die nicht rechnet.
Feindesliebe als gelebte Theologie ist unbequem. Sie widerspricht dem Reflex der Selbstbehauptung. Sie fordert Mut zur Verwundbarkeit. Doch gerade darin liegt ihre prophetische Kraft: Sie konfrontiert die Welt mit der Frage, was es heißt, das Böse nicht mit Bösem zu vergelten – sondern mit einer Liebe, die zur Umkehr ruft.
Vielleicht braucht unsere Gesellschaft nicht „mehr Kirche”, sondern mutigere Christinnen und Christen, die das Kreuz nicht nur als Symbol tragen, sondern als gelebte Praxis radikaler Zuwendung.
Auf zwei Punkte sollten wir noch achten
Auf zwei Punkte sollten wir noch achten: Wer aufmerksam das Neue Testament liest, beobachtet eine sehr scharfe Sprache gegen die Irrlehrer. Grade der Römerbrief lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: “weichet von ihnen…..Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, dass ihr auf die achtet, die Zwietracht und Ärgernis anrichten entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und euch von ihnen abwendet. Denn solche dienen nicht unserm Herrn Christus, sondern ihrem Bauch; und durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden. Deshalb freue ich mich über euch. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber geschieden vom Bösen. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze” (Römer 16, 17–20a).
Der Philipperbrief nennt die Irrlehrer “Hunde” und “böse Arbeiter”, und Johannes warnte: “Wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, nehmt ihn nicht auf in euer Haus und grüßt ihn auch nicht” (2.Johannes 10). Der Grund liegt darin, dass das Neue Testament im Irrlehrer einen Arbeiter des Teufels sieht, der die Gemeinde (Kirche) zerstören will. Deshalb sind Menschen, die verführerische Irrlehre verbreiten, nach seelsorgerlicher Bemühung zu meiden, allerdings nicht zu hassen.
Selbst der sehr scharfe Judasbrief mahnt: „Andere rettet, indem ihr sie aus dem Feuer reißt; bei anderen habt Erbarmen mit Furcht, und hasst sogar das vom Fleisch befleckte Gewand“ (Judas 1,23). Dieser Vers ist Teil einer eindringlichen Mahnung zur geistlichen Wachsamkeit und Barmherzigkeit. Er ruft dazu auf, Menschen, die vom Glauben abirren oder sich in gefährlichen geistlichen Zuständen befinden, nicht aufzugeben, sondern sie mit Entschlossenheit und Liebe zu retten – bildlich gesprochen „aus dem Feuer zu reißen“.
Jakobus schreibt: „Meine Brüder und Schwestern, wenn jemand unter euch abirrt von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen: Wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden” (Jakobus 5,19–20). Dieser Vers ist ein mahnender Aufruf zur geistlichen Wachsamkeit und zur aktiven Nächstenliebe. Es geht nicht um passives Zuschauen, sondern um das mutige Eingreifen, wenn jemand vom Weg der Wahrheit abkommt. Die Rettung „vom Tode“ ist nicht nur eine seelsorgerliche Tat – sie ist ein Ausdruck tiefster Liebe und Verantwortung.
Doch was bedeutet das im Licht von „Liebet eure Feinde“? Liebe ist nicht gleichbedeutend mit Toleranz gegenüber Irrlehre. Wer Gottes Weg torpediert, wer bewusst falsche Lehren verbreitet, dem darf aus falsch verstandener Nächstenliebe kein Raum gegeben werden. Die Schrift mahnt zur Klarheit: Irrlehrer sind mit geistlicher Strenge zu ermahnen – und wenn sie nicht umkehren, klar zu meiden. Geistliche Liebe ist nicht weich, sondern wahrhaftig. Sie sucht das Heil des Anderen, nicht dessen Bestätigung im Irrtum. Sie konfrontiert, wo nötig, und zieht Grenzen, wo Wahrheit kompromittiert wird. Und dennoch gilt Jesu Mahnung und Gebot: “Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel.”
Der zweite Punkt betrifft unser gegenwärtiges Zeugnis: Wer Jesus wahrhaftig folgt, wird unweigerlich als Licht in dieser Welt sichtbar. Doch haben wir den Mut, diese sichtbare Spur wirklich zu nutzen – oder lassen wir die Gelegenheit ungenutzt verstreichen, das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen?
Wir wollen in der Liebe bleiben: Denn in einer Welt, in der Lautstärke oft für Recht gehalten wird und Provokation zur Tagesordnung gehört, ist das stille Zeugnis der Liebe das vielleicht stärkste Zeichen wahrer Nachfolge. Wer sich entschlossen hat, Jesus treu zu folgen, erlebt Anfeindung – nicht selten sogar innerhalb einer Gemeinde. Echte Christen werden bis aufs Blut gereizt, herausgefordert und missverstanden – manchmal durch jene, die sich ebenfalls Christen nennen. Doch gerade hier zeigt sich das wahre Wesen des Evangeliums: Wir bleiben in der Liebe. Nicht aus Schwäche, sondern aus der Kraft Christi, der uns gelehrt hat, selbst unsere Feinde zu lieben. Wir lassen uns nicht von Hass verführen, nicht von Bitterkeit gefangen nehmen. Wo andere mit Beleidigung antworten, bleiben wir ruhig und besonnen. Wo die Lieblosigkeit zur Resignation führt, gehen wir einen Schritt weiter – mit der Liebe, die vom Kreuz geprägt ist.
Ob online, im Alltag oder im persönlichen Gespräch – überall prallen Ideologien, Meinungen und gesellschaftliche Kräfte aufeinander, die uns mundtot machen oder unsere Haltung untergraben wollen. Doch unser Weg bleibt derselbe: Lieben und beten. Nicht aus Naivität, sondern aus Gehorsam gegenüber unserem Herrn, dessen Herz sich nach jeder verlorenen Seele sehnt. Und ja – wir lieben auch jene, die uns verletzen. Nicht, weil sie es verdient hätten, sondern weil sie die Liebe Jesu ebenso dringend brauchen wie wir selbst. Dies ist keine romantisierte Vorstellung, sondern ein geistlicher Auftrag, der uns herausfordert, formt und oft an unsere Grenzen führt. Jakobus 5,19–20 und Judas 1,23 rufen uns zur Wachsamkeit und geistlichen Verantwortung auf. Doch dabei verlieren wir nie das Ziel: die Rettung der Seele, nicht den Triumph im Streit. Unsere Treue zur Wahrheit verbindet sich mit Fürbitte, Geduld und echter geistlicher Liebe.
Hier wollen wir bleiben. Als echte Jünger, nicht perfekte Menschen. Als Liebende, nicht als Streiter. Als Handelnde im Geist Christi, nicht im Geist der Welt. Und wir lernen dabei – jeden Tag neu, mit jeder Verletzung, mit jedem Rückschlag und mit jeder neu geschenkten Gelegenheit, in Liebe zu bestehen. Denn unser Herr und Heiland sagt: “Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel.” Amen.