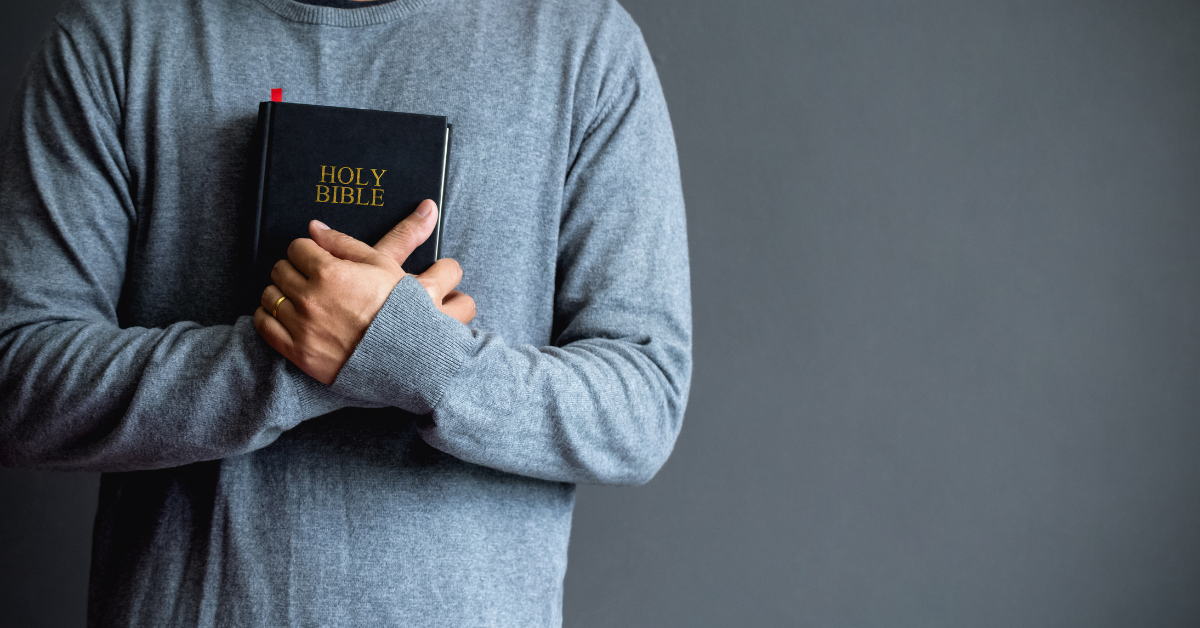1.Johannes 1,2: “…und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist –.…”.
Diese Worte tragen den Glanz einer Offenbarung in sich, die das Herz der christlichen Botschaft berührt. Hier wird nicht von einem abstrakten Prinzip gesprochen, sondern von einer lebendigen Realität – von Jesus Christus selbst. In Ihm ist das göttliche Leben sichtbar geworden. Es tritt in unsere Welt, in unsere Zeit und unsere Zerbrechlichkeit, nicht als Idee, sondern als Person. Das Leben hat ein Gesicht bekommen. Dieses Leben ist kein gewöhnliches – es ist ewig. Es stammt aus der Ewigkeit, es ist Ausdruck des Wesens Gottes. Es ist Leben, das nie beginnt und niemals endet. Es ist nicht von biologischen Prozessen abhängig, nicht gebunden an die Uhr der Zeit, nicht begrenzt durch Geburt und Tod. Im Gegensatz zum menschlichen Leben, das mit dem ersten Atemzug in Richtung Vergänglichkeit schreitet, ist das ewige Leben ein „Sein zum Leben“. Johannes formuliert es noch bildhafter im Evangelium: „Das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst.“ (Johannes 1,5)
Das Licht Christi ist nicht nur Erleuchtung für den Verstand – es ist Heilung für die Seele. Es offenbart das, was uns verborgen war: Dass Leben mehr ist als Dasein. Dass Liebe mehr ist als Emotion. Und dass Ewigkeit mehr ist als endlose Zeit – sie ist Tiefe, sie ist Beziehung, sie ist Gegenwart Gottes. Der Mensch, so hat Heidegger es ausgedrückt, ist ein „Sein zum Tode“. Doch in Christus erscheint ein anderes Sein. Hier begegnet uns eine Existenz, die nicht vom Tod gezeichnet ist, sondern von der Auferstehung. Dieses Licht fordert heraus. Es ist zu hell für Augen, die sich an die Dunkelheit gewöhnt haben. Es offenbart das Unzulängliche, aber auch das Heilige – die Würde, zu der der Mensch gerufen ist. Ewiges Leben ist nicht bloß ein Trost für das Danach – es ist eine Qualität des Lebens im Hier und Jetzt. Wer Christus begegnet, empfängt Anteil an diesem Leben: nicht durch Leistung, sondern durch Gnade. Es ist ein Geschenk, das die Zeit überschreitet und das Herz verwandelt.
Die Fleischwerdung Jesu Christi ist kein beiläufiges Detail des christlichen Glaubens – sie ist der epische Wendepunkt der Heilsgeschichte. Mit diesem Ereignis tritt Gott nicht nur in die Zeit, sondern in die Geschichte, in die sichtbare Welt, in die Menschlichkeit hinein. In Christus offenbart sich das ewige Leben: „Das Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist“ (1. Johannes 1,2). Hier bezeugt Johannes mit innerer Klarheit und geistlicher Autorität das Vorhersein des Sohnes. Die Menschwerdung Jesu ist kein Anfang seines Daseins, sondern seine Sendung aus der ewigen Gegenwart Gottes. Als Jesus sagte: „Ehe Abraham wurde, bin ich“ (Johannes 8,58), deutete er nicht nur seine Präexistenz an – er offenbarte, dass er außerhalb der Zeit steht, im göttlichen „Ich bin“, dem Namen des Ewigen.
In Jesus kommt nicht nur ein Vorbild oder ein Sendbote – es ist Gott selbst, der als Mensch unter uns lebt. Gott selbst kommt in den Sohn. Er sendet nicht nur eine Botschaft – er wird selbst zur Botschaft. Der Sohn, der Vollglanz göttlichen Lebens, bleibt nicht im Verborgenen des Himmels, sondern tritt sichtbar in unsere Welt ein: „Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns“, und seine Herrlichkeit ist keine innerliche Vision, keine mystische Erfahrung einzelner, sondern eine sinnlich erlebbare Wirklichkeit: „Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit“ (Johannes 1,14). Die Apostel bezeugen kein inneres Licht, das sie in der Meditation empfingen. Sie berichten von dem, was sie gesehen, gehört und mit Händen betastet haben (vgl. 1. Johannes 1,1). Die Evangelien gründen auf erlebter, historischer Begegnung mit Jesus von Nazareth. In ihm leuchtete die Majestät Gottes durch Worte, Zeichen, Liebe und letztlich im Kreuz und der Auferstehung.
Wenn man das geschichtliche Fundament des Evangeliums leugnet, entleert man es seiner Kraft. Man reduziert es zu einer symbolischen Philosophie, gut gemeint, aber ohne Anspruch auf Wahrheit. Der christliche Glaube aber gründet auf einem realen, in Raum und Zeit geschehenen Ereignis: Gott wurde Mensch – und wir sahen ihn.
Dieses Geschehen ist Einladung und Herausforderung zugleich. Es sprengt die Grenzen aller religiösen Vorstellung:
- Es ist kein Aufstieg des Menschen zu Gott, sondern Gottes Abstieg zu uns.
- Es ist kein menschlich erdachtes Ideal, sondern göttlich geschenkte Realität.
- Es ist kein Mythos, sondern Geschichte.
Die Inkarnation des Sohnes ist der Anfang der christlichen Hoffnung. Denn wenn Gott selbst unsere Existenz geteilt hat, ist keine Dunkelheit zu tief, kein Schmerz zu fern, kein Tod endgültig. Das Licht, das in der Finsternis scheint, leuchtet bis heute. Es leuchtet in der Person Jesu – in seiner Liebe, in seinem Ruf, in seiner Gegenwart unter uns.
Es ist wichtig, mit aller Klarheit zu betonen: Die historische Wahrheit begründet den Glauben nicht – er entspringt nicht aus der Logik eines Ereignisprotokolls. Und doch wäre der Glaube ohne die historische Zuverlässigkeit der biblischen Zeugen seiner Glaubwürdigkeit beraubt. Der Glaube richtet sich nicht auf die Historie als Gegenstand der Anbetung. Aber die Historie ist der Wurzelboden des glaubenweckenden Zeugnisses. Ohne sie wird die Offenbarung zu einer beliebig interpretierbaren Idee, einer philosophischen Projektion, die je nach ideologischer oder kultureller Prägung neu gedeutet werden kann – wie es in Teilen der heutigen evangelischen Kirche bereits geschieht.
Johannes selbst kämpfte diesen Kampf gegen die Irrlehrer seiner Zeit, die das Fleischwerden des Wortes leugneten und die Erscheinung des Sohnes in der Geschichte vergeistigten. Sein Zeugnis ist entschieden konkret: „Was wir gehört, was wir gesehen mit unseren Augen, was wir betrachtet und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens … das verkündigen wir euch“ (1. Johannes 1,1–3). Der Glaube entsteht nicht dadurch, dass man einzelne Ereignisse der Vergangenheit wie Beweise aneinanderreiht. Er wächst nicht aus einem nüchternen Bericht, sondern aus dem lebendigen Zeugnis von Menschen, die Gottes Handeln erlebt haben.
Dies ist keine mystische Erfahrung, keine visionäre Erscheinung im Innern – sondern das Bekenntnis zu einem geschichtlichen Ereignis, das sinnlich erfahrbar war. Die historisch-kritische Theologie, so wertvoll manche methodische Einsichten auch sein mögen, läuft Gefahr, den Christus der Geschichte in einen Christus der Interpretation zu verwandeln – ein veränderliches Bild, das nicht trägt, das sich immer wieder anpasst oder neu interpretiert wird, je nach Zeitgeist oder persönlicher Vorstellung – wie eine Idee, die sich beliebig formen lässt.
Wenn man also die historische Wirklichkeit der Bibel aufgibt, wird das Bild von Christus zu etwas, das jeder nach Belieben deuten kann – und verliert damit seine feste Gestalt und Wahrheit.
Die Gemeinde Jesu aber bekennt sich zu einem Gott, der handfest in diese Welt eingetreten ist – der in Jesus von Nazareth gelebt, geliebt, gelitten und auferstanden ist. Dieser Glaube steht und fällt mit der Wirklichkeit der Inkarnation und mit der Zuverlässigkeit der biblischen Zeugen. Die Evangelien sind nicht bloß religiöse Erzählungen – sie sind Berichte von Augenzeugen, durchdrungen vom Heiligen Geist, und getragen von der Sendung, Wahrheit zu verkünden.
Wenn die Kirche dies nicht mehr bezeugt, verliert sie ihren Auftrag und wird zum Ort theologischer Beliebigkeit. Es ist daher kein Rückschritt, sondern ein geistlicher Aufbruch, wenn Gemeinden heute neu um das geschichtliche Fundament des biblischen Wortes ringen – nicht aus Dogmatismus, sondern aus dem tiefen Verlangen, dem lebendigen Gott treu zu bleiben.
Das Wort Gottes – erschienen, bezeugt, verkündigt: „…und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist…“ (1. Johannes 1,2). In diesen Worten liegt der Kern unseres Glaubens: Gott hat sich nicht verborgen gehalten, sondern ist in Jesus Christus in die Geschichte getreten – sichtbar, hörbar, greifbar. Dieses Leben, das beim Vater war, ist uns erschienen, und die Augenzeugen – seine Apostel – haben es bezeugt und weitergegeben.
Die Bibel ist kein Mythos, kein philosophisches Gedankenmodell, sondern das zuverlässige, unverfälschte Zeugnis jener, die Gottes Handeln leibhaftig erlebt haben. Sie bezeugen nicht bloß Ideen – sie berichten von dem, was sie gesehen und gehört haben. Darum ist das Wort Gottes historische Wahrheit, die trägt. Es ist nicht Produkt menschlicher Deutung, sondern Gottes Selbstoffenbarung in Raum und Zeit. Wer es relativiert, löst das Fundament des Glaubens auf; wer es bekennt, stellt sich unter das Licht des lebendigen Gottes. Amen.