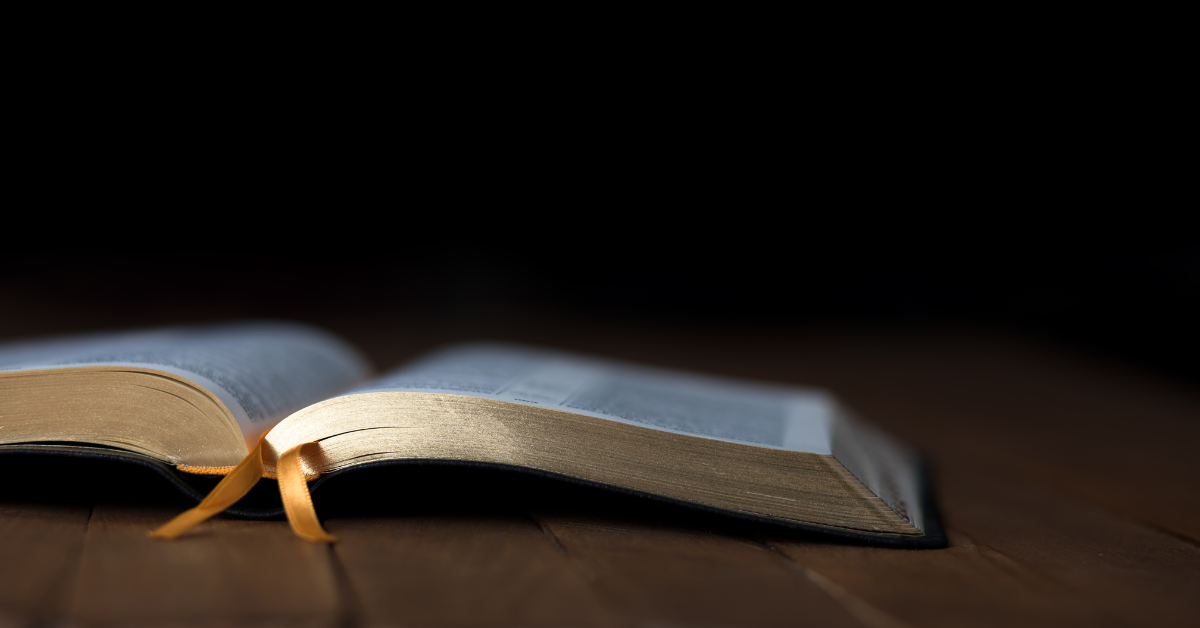Biblischer Kommentar: „Jesus hat sich dazu nicht geäußert“ – Schweigen als Freibrief zur Sünde?
In der gegenwärtigen ethischen Debatten innerhalb kirchlicher und gesellschaftlicher Kontexte wie zum begegnet man immer wieder dem Argument: „Jesus hat sich dazu nicht geäußert.“ Dieses Argument wird häufig verwendet, um moralische Positionen zu relativieren oder um Verhaltensweisen zu rechtfertigen, die im Widerspruch zur biblischen Ethik stehen. Doch eine solche Argumentation ist nicht nur exegetisch fragwürdig, sondern auch theologisch problematisch.
1.Das Schweigen Jesu – ein hermeneutisches Missverständnis
Die Evangelien sind keine vollständigen Protokolle aller Aussagen Jesu. Johannes selbst schreibt: „Es gibt noch vieles andere, was Jesus getan hat; wenn man das alles aufschreiben wollte, so würde die Welt die Bücher nicht fassen“ (Johannes 21,25). Das Schweigen Jesu zu bestimmten Themen ist daher kein Beweis für Zustimmung oder Ablehnung, sondern Ausdruck der narrativen und theologischen Auswahl der Evangelisten. Wer aus dem Schweigen Jesu eine ethische Erlaubnis ableitet, begeht einen hermeneutischen Fehlschluss: Er interpretiert das Nichtgesagte als Norm.
Dies ist nicht nur exegetisch unhaltbar, sondern auch geistlich gefährlich. Denn Schweigen ist kein ethischer Maßstab. Es ist ein leerer Raum, der nicht mit menschlichen Wunschvorstellungen gefüllt werden darf. Die Heilige Schrift ist kein Lückentext, den wir nach Belieben ergänzen können. Vielmehr ist sie ein inspiriertes Zeugnis göttlicher Wahrheit, das in seiner Gesamtheit verstanden werden muss. Wer das Schweigen Jesu als Freibrief zur Sünde deutet, stellt sich selbst über die Offenbarung und macht sich zum Richter über das Wort Gottes. Er ersetzt göttliche Autorität durch subjektive Interpretation und öffnet damit Tür und Tor für moralische Beliebigkeit. Doch das Evangelium ruft nicht zur Beliebigkeit, sondern zur Umkehr. Es lädt nicht zur Selbstrechtfertigung ein, sondern zur Heiligung. Jesu Schweigen ist kein Freiraum für Sünde, sondern ein Prüfstein für unsere Demut: Sind wir bereit, auch dort gehorsam zu sein, wo wir keine explizite Anweisung finden – allein aus Liebe zu Christus und aus Ehrfurcht vor seinem Wort?
Beispiele für ethisches Schweigen Jesu – und warum sie keine Freibriefe sind.…
1.Homosexualität
- Was Jesus nicht direkt sagte: In den Evangelien gibt es keine explizite Aussage Jesu zur gleichgeschlechtlichen Sexualität.
- Warum das kein Freibrief ist: Jesus bestätigte die Schöpfungsordnung: „Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat?“ (Matthäus 19,4–6). Damit bekräftigt er die Ehe zwischen Mann und Frau als göttliches Ideal. Zudem ist die gesamte Schrift – einschließlich der Briefe des Paulus – klar in ihrer ethischen Bewertung gleichgeschlechtlicher Praxis (z. B. Römer 1,26–27; 1 Korinther 6,9–10).
2.Abtreibung
- Was Jesus nicht direkt sagte: Es gibt keine überlieferte Aussage Jesu zur Abtreibung.
- Warum das kein Freibrief ist: Die jüdische Ethik zur Zeit Jesu war eindeutig lebensbejahend. Die Schrift spricht von der Heiligkeit des Lebens, auch im Mutterleib (z. B. Psalm 139,13–16; Jeremia 1,5). Jesus selbst zeigt tiefes Mitgefühl für Kinder und warnt davor, ihnen zu schaden (Matthäus 18,6). Sein Schweigen ist also eingebettet in eine Kultur, die das Leben als Geschenk Gottes versteht.
3.Sklaverei
- Was Jesus nicht direkt sagte: Jesus hat Sklaverei nicht ausdrücklich verurteilt.
- Warum das kein Freibrief ist: Die Botschaft Jesu von der Gleichwertigkeit aller Menschen („Ihr alle seid Brüder“ – Matthäus 23,8) und die paulinische Betonung der Einheit in Christus („Da ist weder Sklave noch Freier“ – Galalter 3,28) untergraben die Grundlagen jeder Form von Ausbeutung. Die frühe Christenheit war geprägt von einer Ethik der Nächstenliebe, die mit der Institution der Sklaverei unvereinbar ist.
4.Umweltzerstörung
- Was Jesus nicht direkt sagte: Es gibt keine direkte Aussage Jesu zur Bewahrung der Schöpfung.
- Warum das kein Freibrief ist: Jesus lebte in tiefer Verbundenheit mit der Natur – er sprach in Gleichnissen von Vögeln, Lilien, Weizen und Weinbergen. Die Bibel beginnt mit dem Auftrag zur verantwortungsvollen Herrschaft über die Erde (1.Mose 1,28) und endet mit der Vision einer erneuerten Schöpfung (Offenbarung 21). Die Ethik Jesu ist durchdrungen von Respekt vor Gottes Werk.
Jesu Schweigen ist nie isoliert zu betrachten. Es steht im Kontext der gesamten Heiligen Schrift, der jüdischen Ethik seiner Zeit und seiner eigenen Botschaft von Liebe, Gerechtigkeit und Heiligkeit. Schweigen ist kein ethischer Freiraum, sondern ein Ruf zur geistlichen Verantwortung. Die Frage ist nicht: Hat Jesus es ausdrücklich verboten? – sondern: Was offenbart sein Leben, seine Lehre und sein Geist über Gottes Willen?
2.Die Einheit von Jesus und dem Wort Gottes
Jesus ist nicht nur ein Lehrer unter vielen – er ist das fleischgewordene Wort Gottes (Johannes 1,1–14). Seine Autorität speist sich nicht nur aus dem, was er sagte, sondern auch aus dem, was er verkörperte. Er selbst sagte: „Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen“ (Matthäus 5,17). Damit bestätigt er die göttliche Ordnung, wie sie in der gesamten Heiligen Schrift offenbart ist. Wer also meint, Jesu Schweigen hebe alttestamentliche oder paulinische Aussagen auf, verkennt die Kontinuität der göttlichen Offenbarung.
Eine solche Sichtweise ignoriert die Einheit der Heiligen Schrift und konstruiert künstliche Gegensätze zwischen den verschiedenen Teilen der Bibel. Doch Jesus selbst bezeugt: „Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Propheten aufzuheben, sondern um sie zu erfüllen“ (Matthäus 5,17). Damit stellt er klar, dass seine Lehre nicht im Widerspruch zur bisherigen Offenbarung steht, sondern deren tiefere Bedeutung offenbart. Auch Paulus betont diese Kontinuität, wenn er schreibt: „Denn alles, was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben“ (Römer 15,4). Die Heilige Schrift ist kein Flickenteppich, sondern ein gewebtes Ganzes, in dem Christus das Zentrum bildet.
Jesus beruft sich immer wieder auf das Alte Testament, etwa bei der Versuchung in der Wüste („Es steht geschrieben…“ – Matthäus 4,4–10), bei der Auslegung des Sabbats (Markus 2,27) oder bei der Zusammenfassung des Gesetzes in den beiden Liebesgeboten (Matthäus 22,37–40). Auch Paulus gründet seine Ethik auf die Heilige Schrift, wenn er etwa in 1 Korinther 10,11 schreibt: „Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist.“ Die alttestamentlichen Gebote und Prinzipien sind für ihn keine überholten Regeln, sondern geistliche Wegweiser für die Gemeinde. Die Kontinuität der Offenbarung zeigt sich auch in der Beschreibung Jesu als „das Wort“ (Johannes 1,1), das „Fleisch wurde“ (Johannes 1,14). Dieses Wort ist nicht neu im Sinne eines Bruchs, sondern neu im Sinne der Erfüllung. Die Propheten kündigten ihn an, die Psalmen sangen von ihm, das Gesetz wies auf ihn hin.
Wer also meint, Jesu Schweigen könne die Autorität der Schrift relativieren, verkennt, dass Christus selbst die Heilige Schrift ist – in Person, in Wahrheit und in Vollmacht.
3.Die ethische Tiefe der Botschaft Jesu
Jesus ging über die bloße Buchstabentreue hinaus. Er vertiefte das Gesetz, indem er auf die Herzenshaltung abzielte. „Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst nicht töten. Ich aber sage euch: Wer seinem Bruder zürnt, ist des Gerichts schuldig“ (Matthäus 5,21–22). Diese Radikalisierung zeigt: Jesus war nicht daran interessiert, moralische Grauzonen zu schaffen, sondern das Wesen der Sünde zu entlarven. Er verschärfte nicht das Gesetz, um es unerfüllbar zu machen, sondern um deutlich zu machen, dass wahre Gerechtigkeit nicht im äußeren Gehorsam beginnt, sondern im Inneren des Menschen. Die Bergpredigt ist kein ethisches Ideal für eine ferne Zukunft, sondern ein Ruf zur Umkehr im Hier und Jetzt. Jesus fordert nicht nur Verhalten, sondern Gesinnung. Er spricht nicht nur von Taten, sondern von Gedanken, Blicken, Worten – von dem, was im Verborgenen geschieht.
Sein Schweigen zu bestimmten Themen ist daher kein Freibrief, sondern ein Aufruf zur geistlichen Reife und zur Orientierung am Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift. Wer sich auf das Schweigen Jesu beruft, um moralische Grenzen zu verschieben, verkennt, dass Jesus selbst das Licht ist, das alle Dunkelheit durchdringt (Johannes 8,12). Er ist nicht der Erlauber der Sünde, sondern der Erlöser aus ihr. Seine Lehre zielt auf die Wiederherstellung des Menschen nach dem Bild Gottes – nicht auf die Anpassung an den Zeitgeist. Die Heilige Schrift bezeugt: „Denn ⟨der HERR sieht⟩ nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der HERR sieht auf das Herz“ (1 Samuel 16,7).
Diese Perspektive zieht sich durch das gesamte Wirken Jesu. Er lobt nicht die Gesetzestreue der Pharisäer, sondern die Demut des Zöllners. Er tadelt nicht die Sünder, die umkehren, sondern jene, die sich selbst für gerecht halten. Jesu Schweigen ist daher kein ethisches Vakuum, sondern ein Raum für geistliche Verantwortung. Es fordert den Menschen heraus, nicht nach Minimalanforderungen zu fragen, sondern nach dem Willen Gottes zu suchen. Die Frage lautet nicht: Was hat Jesus explizit verboten? – sondern: Was offenbart sein Leben, seine Liebe, seine Heiligkeit über den Weg, den wir gehen sollen? Wer diesen Weg sucht, wird nicht im Schweigen Jesu stolpern, sondern in seiner Wahrheit aufrecht gehen.
4.Gnade und Wahrheit – kein Widerspruch
Jesus brachte Gnade – aber nicht ohne Wahrheit. Denn es steht geschrieben: “Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben; die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden” (Johannes 1,17). Diese Verbindung ist kein Zufall, sondern Ausdruck des göttlichen Wesens. Gnade ohne Wahrheit wäre bloße Toleranz, Wahrheit ohne Gnade wäre bloßes Gericht. Doch Christus vereint beides: Er vergibt die Schuld und offenbart zugleich die Heiligkeit Gottes. Wer Gnade als Deckmantel für Sünde missbraucht, verkehrt das Evangelium ins Gegenteil. Er macht aus der rettenden Botschaft eine billige Rechtfertigung für moralische Beliebigkeit. Doch die Heilige Schrift warnt eindringlich vor solcher Verzerrung: „Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade mächtig werde? Das sei ferne!“ (Römer 6,1–2).
Gnade ist kein Freibrief, sondern ein Ruf zur Umkehr. Sie hebt die Sünde nicht auf, sondern überwindet sie durch die Kraft der Vergebung und die Erneuerung des Herzens.
Die Nachfolge Jesu bedeutet nicht moralische Beliebigkeit, sondern Heiligung im Licht seiner Wahrheit. „Heiligt euch, denn ich bin heilig“, spricht der Herr (1 Petrus 1,16). Diese Heiligung ist kein äußerer Zwang, sondern eine innere Bewegung – ein Leben, das sich dem Willen Gottes unterstellt, nicht aus Angst, sondern aus Liebe. Jesus sagt: „Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten“ (Johannes 14,15). Die Liebe zu Christus zeigt sich nicht in der Umgehung seiner Worte, sondern im Gehorsam gegenüber seiner Wahrheit. Wer die Gnade Christi empfängt, wird nicht in der Sünde verharren, sondern sich nach dem Licht sehnen, das alles Dunkel vertreibt.
Die Gemeinde Christi ist berufen, ein Zeugnis dieser Wahrheit zu sein – nicht angepasst an den Zeitgeist, sondern verwurzelt im Wort. „Ihr seid das Licht der Welt“ (Matthäus 5,14), sagt Jesus. Dieses Licht leuchtet nicht durch moralische Kompromisse, sondern durch Klarheit, Demut und Treue. Gnade ist kein Schleier, der die Wahrheit verhüllt, sondern das Licht, das den Weg zur Wahrheit eröffnet. Wer in dieser Gnade lebt, wird nicht nach Ausreden suchen, sondern nach Heiligung streben – aus Dankbarkeit, aus Ehrfurcht und aus Liebe zu dem, der uns zuerst geliebt hat.
Die Worte Jesu sind nicht nur Trost, sondern auch Herausforderung. Sie rufen nicht zur Selbstbestätigung, sondern zur Umkehr. Sein Schweigen ist kein Raum für Beliebigkeit, sondern ein Ruf zur geistlichen Verantwortung. Wer Christus nachfolgt, darf sich nicht auf das berufen, was er nicht ausdrücklich gesagt hat, sondern muss sich dem stellen, was er offenbart hat – in Wort, in Tat, im Geist. Die Heilige Schrift ist kein Baukasten für individuelle Moral, sondern ein lebendiges Zeugnis göttlicher Wahrheit. Gnade ist kein Vorwand, sondern ein Geschenk, das zur Heiligung führt. Wahrheit ist kein Zwang, sondern ein Licht, das den Weg weist. Die Nachfolge Jesu ist kein bequemer Weg, sondern ein schmaler Pfad – aber er führt zum Leben. Mögen wir nicht nach Ausflüchten suchen, sondern nach Gehorsam. Nicht nach Bestätigung, sondern nach Wahrheit. Nicht nach dem Schweigen, sondern nach der Stimme des guten Hirten, der uns ruft: „Folge mir nach.“ Amen.